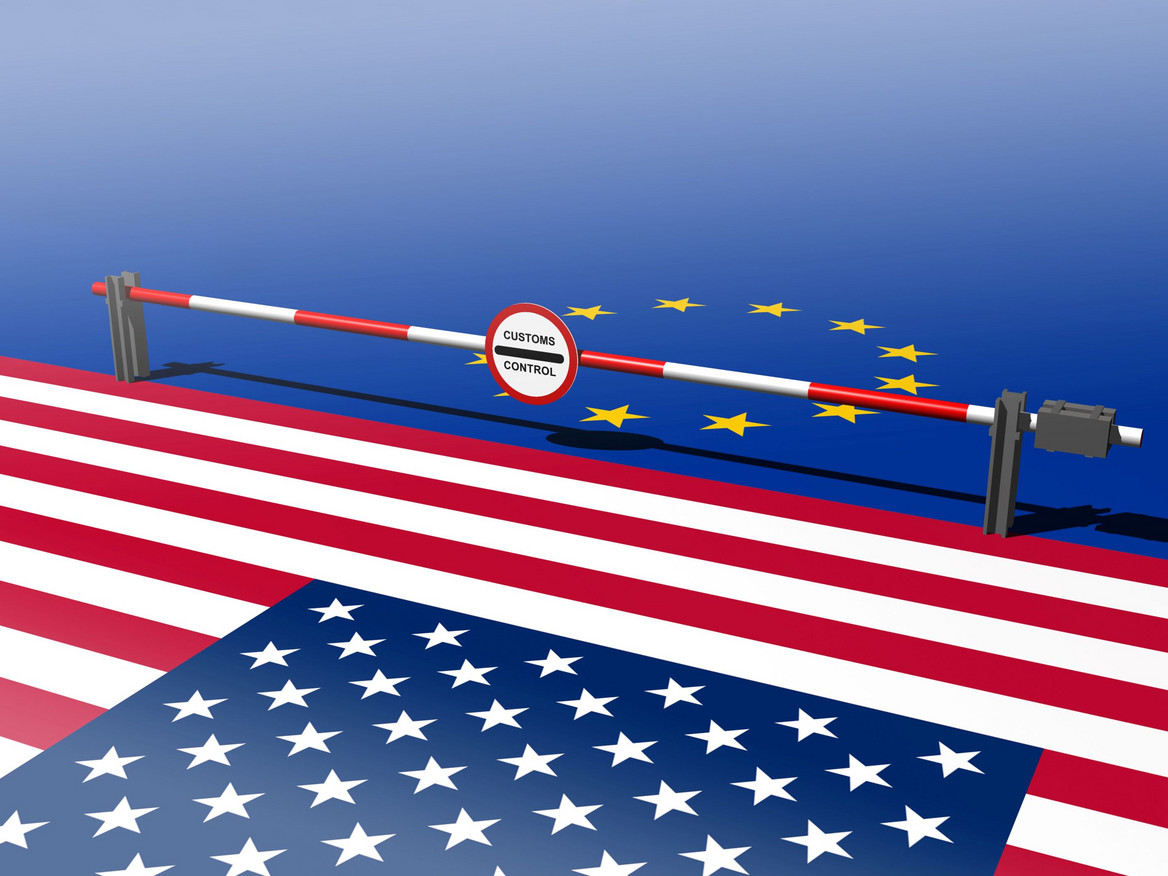Das Wichtigste auf einen Blick
- Die deutsche Chemie- und Pharmabranche ist stark von Importen aus China abhängig – De‑Risking soll dies mindern.
- Unternehmen diversifizieren Lieferketten („China plus“), ohne sich aus China zurückzuziehen; denn der Markt bleibt wirtschaftlich und technologisch wichtig.
- DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier plädiert für einen verlässlichen Rahmen, faire Wettbewerbsbedingungen und umsichtiges Risikomanagement.
Von kritischer Abhängigkeit spricht man, wenn mindestens die Hälfte einer benötigten Warengruppe aus einem einzigen Land stammt. Vor allem die deutsche Chemie- und Pharmabranche ist mit 89 betroffenen Warengruppen von Importen aus China abhängig – mehr als jeder andere Industriezweig. Dies hat das Institut der deutschen Wirtschaft ermittelt.
Was die Einfuhr von Chemieerzeugnissen nach Rheinland-Pfalz betrifft, so steht China nach Angaben des Statistischen Landesamtes auf Platz 6 der wichtigsten Lieferländer, hinter europäischen Ländern und den USA. Als Zielland rheinland-pfälzischer Chemieerzeugnisse rangiert China an achter Stelle.
Die Bundesregierung unterstützt deutsche Unternehmen dabei, ihre Lieferketten breiter aufzustellen. Dies ist Teil ihrer De-Risking-Strategie. Wie die Außenhandelsorganisation GTAI berichtet, bauen etliche deutsche Unternehmen, die in China präsent sind, ihre Lieferketten innerhalb der Volksrepublik aus, um internationale Logistikstörungen abzufedern. Die meisten von ihnen erwägen eine stärkere Kooperation mit chinesischen Partnern, um ihr dortiges Geschäft auszubauen.
DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier plädiert für ein umsichtiges Risikomanagement und benennt, wie das in der Praxis aussieht.
Herr Treier, warum ist ein De-Risking für deutsche Industrieunternehmen mit Blick auf China weiterhin geboten?
Das Interesse der deutschen Wirtschaft an einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit China ist weiterhin hoch – trotz geopolitischer Spannungen. Das zeigen nicht zuletzt die regelmäßigen Geschäftsklimaumfragen der Auslandshandelskammern vor Ort. Gleichzeitig ist klar: Wer langfristig erfolgreich bleiben will, muss Risiken realistisch bewerten und aktiv managen.
De-Risking ist dabei kein Rückzug, sondern Ausdruck wirtschaftlicher Vernunft. Deutsche Unternehmen sprechen sich bewusst für ein umfassendes Risikomanagement aus, um die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen mit China nachhaltig zu stabilisieren. Denn China ist und bleibt ein zentraler Absatz- und Beschaffungsmarkt – und entwickelt sich zunehmend auch zu einem wichtigen Innovations- und Technologiepartner.
Gleichzeitig bestehen erhebliche Abhängigkeiten von chinesischen Vorprodukten, etwa bei Halbleitern oder Seltenen Erden. Hinzu kommen zunehmende Unsicherheiten durch Industriepolitik, regulatorische Eingriffe und geopolitische Spannungen. De-Risking heißt deshalb: Abhängigkeiten reduzieren, ohne die wirtschaftlichen Chancen aus dem Blick zu verlieren.
Welche Maßnahmen haben deutsche Industrieunternehmen typischerweise bereits ergriffen?
Viele Unternehmen sind beim De-Risking längst einen guten Schritt vorangekommen. Sie haben ihre Lieferketten überprüft, alternative Bezugsquellen identifiziert und haben sich etwaige Abhängigkeiten bewusst gemacht. Parallel werden Produktions- und Beschaffungsstrukturen breiter aufgestellt – häufig nicht als Abkehr von China, sondern als Ergänzung.
Zugleich investieren deutsche Unternehmen weiter vor Ort. China bleibt ein wichtiger Markt, gerade auch für Forschung, Entwicklung und Innovation – und hinsichtlich der Frage, was machen wichtige Wettbewerber. De-Risking bedeutet für viele Unternehmen einen „China plus“-Ansatz, also die Kombination aus Engagement in China und zusätzlicher regionaler Diversifizierung.
Was ist noch zu tun – von deutscher, europäischer und chinesischer Seite?
Für deutsche und europäische Unternehmen braucht es vor allem verlässliche Rahmenbedingungen. Die EU ist gefordert, ihre strategische Autonomie zu stärken – durch eine koordinierte Handelspolitik, technologische Eigenständigkeit und gezielte wirtschaftlich fundierte Gegenstrategien. Investitionen in Forschung und Innovation sowie die Diversifizierung von Lieferketten sind richtig und notwendig, entfalten ihre Wirkung jedoch erst mittelfristig. Kurzfristig braucht es ein geschlossenes, souveränes und selbstbewusstes Auftreten Europas nach außen – auch gegenüber China.
Von chinesischer Seite bleibt entscheidend, dass gleiche Wettbewerbsbedingungen für ausländische Unternehmen geschaffen werden. Derzeit sind deutsche Unternehmen in China aufgrund industriepolitischer Vorgaben weiterhin unterschiedlichen Diskriminierungs- und Beschränkungsstufen ausgesetzt. Mehr Marktzugang, Transparenz und Rechtssicherheit wären ein starkes Signal – und die beste Grundlage für eine stabile, partnerschaftliche Wirtschaftsbeziehung.