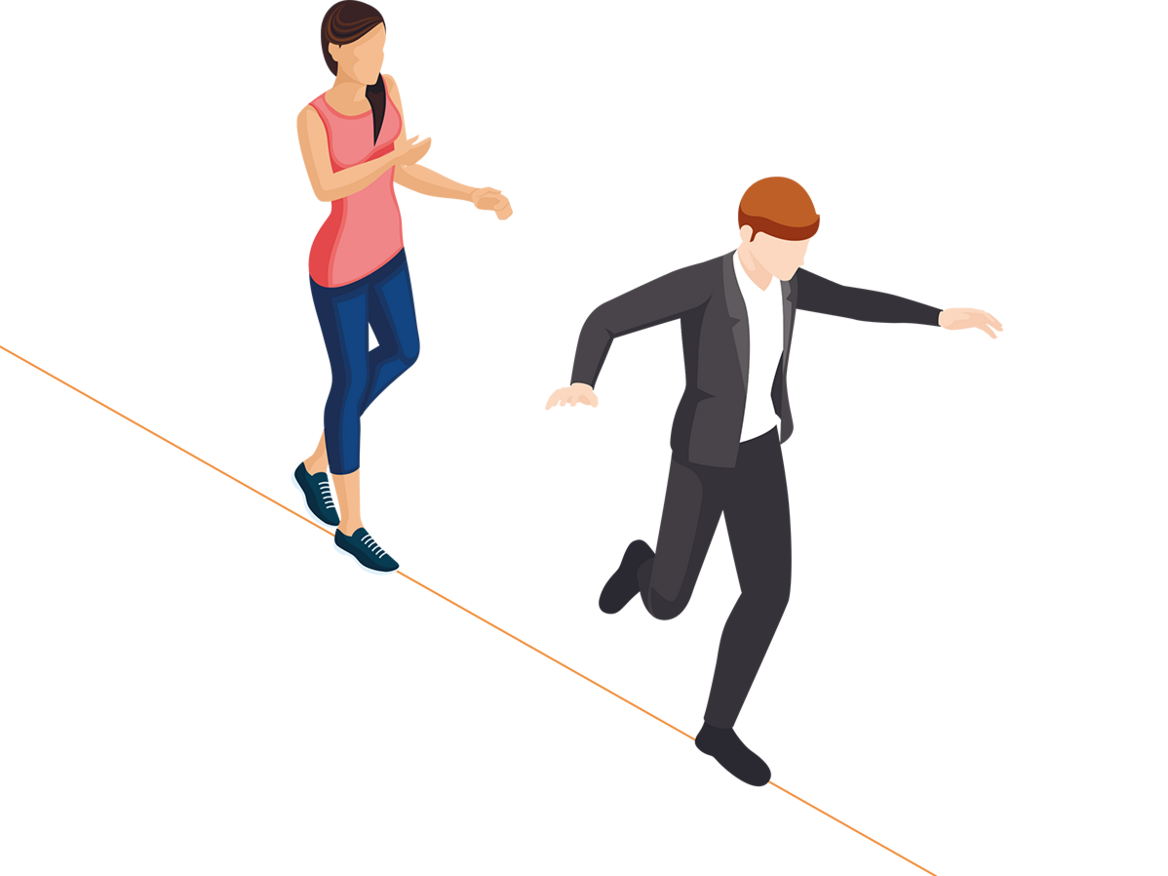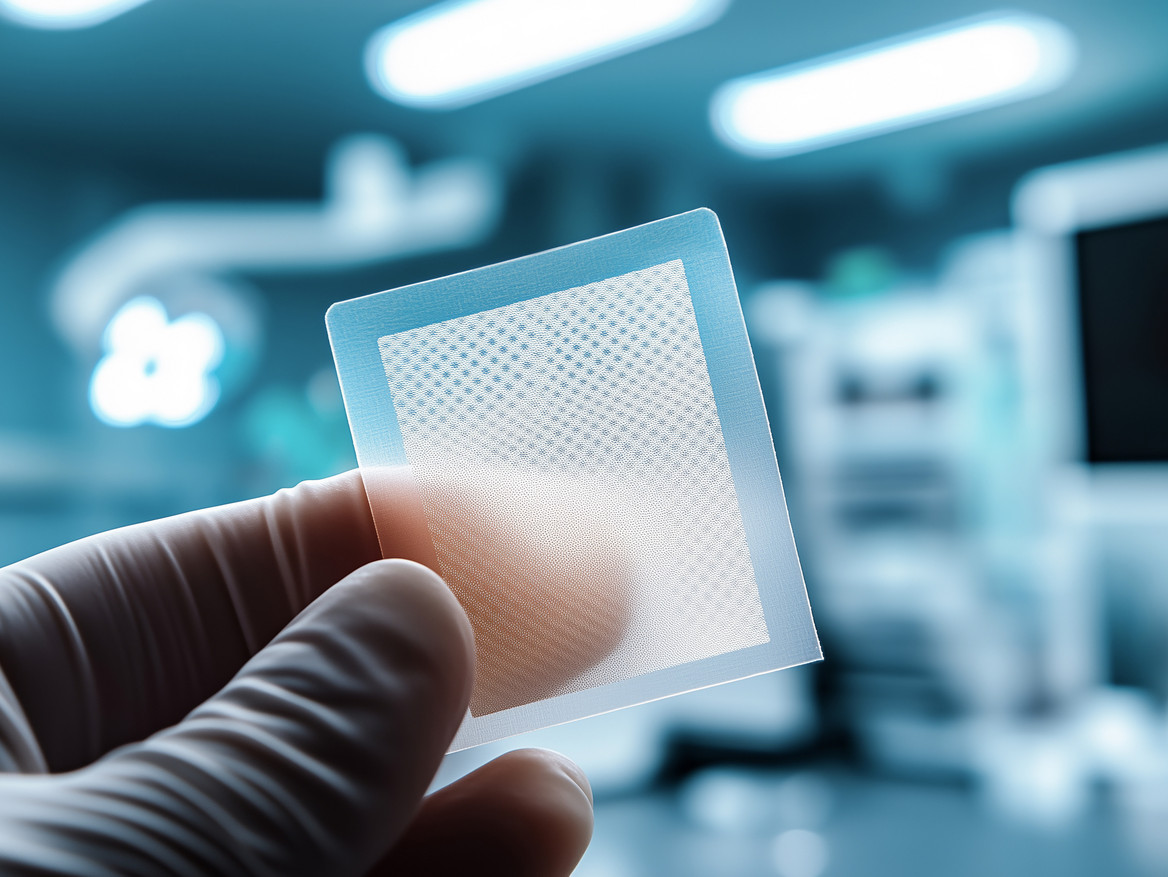Eine Frage in den Computer tippen und einen augenscheinlich perfekten Text als Antwort bekommen? Die Einführung des Chatbots ChatGPT vor knapp eineinhalb Jahren hat gezeigt, wie sich E-Mails, Aufsätze und ganze Abhandlungen ohne viel Arbeit erstellen lassen. Künstliche Intelligenz (KI) ist für viele Menschen spätestens seitdem kein abstrakter Fachbegriff mehr, sondern im Alltag angekommen.
Das heißt: Maschinen sind in der Lage, Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen und selbst Kreativität zu imitieren. Sie erfassen Zusammenhänge, aus denen sie Schlussfolgerungen ableiten, das nennt sich maschinelles Lernen. Das hat gravierende Folgen für die Unternehmen und die Beschäftigten – auch in der Chemieindustrie.
Digitale Evolution
In den Laboren, Produktionshallen und Büros der Chemieunternehmen spielt die Technologie schon lange eine wichtige Rolle, weiß Christian Bünger, Experte für Digitalpolitik und Digitalisierung im Verband der Chemischen Industrie (VCI). „KI hatte ihren Ursprung in den 1950er Jahren mit dem wegweisenden Papier „Computing Machinery and Intelligence“ von Alan Turing, aber erst ab 2010 begann der kommerzielle Durchbruch“, sagt er. Möglich wurde dies, weil ausreichend schnelle Computerchips immer breiter verfügbar wurden.
Zum Vergleich: Moderne Smartphones sind heute millionenfach leistungsfähiger als der Computer, den die NASA 1969 für die Mondlandung nutzte. Außerdem haben im Vergleich zu früher die Datenmengen massiv zugenommen. Es wird schlicht mehr gespeichert und analysiert, was der KI-Entwicklung enormen Schwung verliehen hat. Inzwischen gilt die Wirkungsmacht von KI als revolutionär: Sie kann Prozesse effizienter machen, Produkte verbessern und potenziell sogar den Durchbruch im Kampf gegen Krankheiten schaffen.
KI hilft zum Beispiel in der Produktion dabei, Qualitätsprobleme zu erkennen oder Produktchargen zu überwachen. Eine weiterer Anwendungsfall ist die „Predictive Maintenance“, also die vorausschauende Wartung, um Ausfallzeiten von Anlagen zu reduzieren. Auch Chatbots werden im Vertrieb und Einkauf eingesetzt, etwa als erste Anlaufstelle im Kundenservice.
„KI funktioniert nicht ohne die Mitarbeiter. Am Ende muss immer jemand draufschauen“
VCI-Digitalexperte Christian Bünger
Schnellere Markteinführung
Ein Bereich, in dem die Chemiebetriebe besonders große Hoffnungen in KI setzen, ist die Forschung. Hier ist sie wie ein digitaler Detektiv, der hilft, die richtigen Schlüsse zu ziehen sowie Zeit und Kosten zu sparen. „Es geht darum, Ereignisse vorherzusagen, um dann die Anzahl der Experimente zu reduzieren“, erklärt Bünger. KI-Systeme können dabei unterstützen, neue Verbindungen zu entdecken und zu erahnen, wie verschiedene Chemikalien miteinander reagieren. Statt im Blindflug forschen die Wissenschaftler noch zielgerichteter und effizienter.
Ein Beispiel ist der Supercomputer „Quriosity“ des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen. Seine Rechen-Power von 3 Petaflops (3 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde) entspricht etwa der von 20.000 Laptops und ermöglicht die Simulation von Materialeigenschaften. Damit testen die Forscher die Kombination hunderttausender Stoffe, noch bevor sie sich den Laborkittel überstreifen. Das verkürzt den Weg bis zur Markteinführung neuer Produkte deutlich, heißt es aus dem Konzern.
Doch nicht nur in technisch-chemischen Feldern, sondern auch in anderen Bereichen kann KI bedeutende Vorteile bieten. Pharmaunternehmen untersuchen bereits die Möglichkeit, mithilfe von KI personalisierte, also für den Menschen maßgeschneiderte Medikamente zu entwickeln. „Das kann vieles für den Patienten und seine Behandlung vereinfachen, besonders wenn es darum geht, Wechselwirkungen zu erkennen“, erklärt der VCI-Experte. Zu Wechselwirkungen kann es kommen, wenn zum Beispiel ein Blutdruckmedikament und ein Antibiotikum zusammen eingenommen werden und unerwünschte Nebenwirkungen verursachen.
Vorsicht vor dem Daten-Tümpel
Eine grundlegende Voraussetzung ist jedoch der Zugang zu umfangreichen, qualitativ hochwertigen Datensätzen. Bünger spricht vom sogenannten „Daten-Tümpel“: Liegen Informationen nur unstrukturiert oder unzureichend vor, weil zum Beispiel nicht genügend Laborbücher digitalisiert und eingespeist wurden, fischt auch eine KI im Trüben. Dies kann zu falschen Schlüssen führen. Eine weitere Hürde ist, Betriebsgeheimnisse und personenbezogene Daten zu schützen. Es besteht die Gefahr, dass sensible Informationen in falsche Hände geraten, da viele KI-Modelle Informationen speichern, sodass potenziell Dritte darauf zugreifen können.
Neue Anforderungen an Beschäftigte
Während eine KI Daten zu Informationen verarbeitet, bleibt es in der Verantwortung des Menschen, daraus Entscheidungen abzuleiten. Es ist seine Aufgabe, die Ergebnisse richtig zu nutzen. „KI funktioniert nicht ohne die Mitarbeiter. Am Ende muss immer jemand draufschauen, die Ergebnisse prüfen und Chancen und Risiken abwägen“, betont Bünger.
Verdrängt KI jetzt Arbeitsplätze? Die Befürchtung, dass nun massenweise Stellen in der Chemieindustrie wegfallen, ist wohl übertrieben. Das zeigt auch eine Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung aus dem Jahr 2020: Einfache Labortätigkeiten sind demnach bereits seit längerer Zeit ohnehin automatisiert. Was sich ändern wird, ist der wachsende Bedarf an Computer- und Datenexperten sowie die steigenden Anforderungen an die Arbeitskräfte.
So betont der Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) in seiner aktuellen Analyse den unvermeidlichen „Skillshift“ innerhalb der Arbeitswelt. IT-Fähigkeiten und das Verständnis für Nachhaltigkeit werden immer entscheidender, während traditionelle Kompetenzen, speziell in kaufmännischen und laborbezogenen Feldern, weniger nachgefragt sind. Doch bietet dieser Wandel auch Chancen: Sollte die Chemieindustrie in Deutschland die digitale und technologische Transformation erfolgreich meistern, könnten bis zum Jahr 2030 sogar zusätzliche 25.000 Arbeitsplätze entstehen.