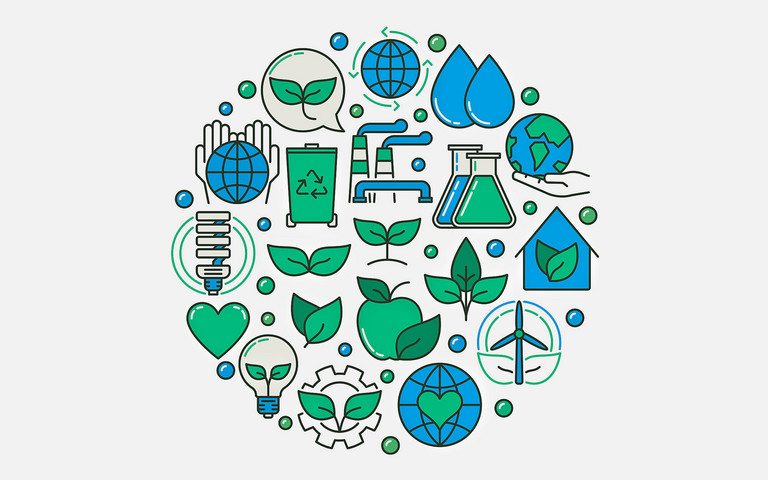Kreislaufwirtschaft oder auch „Circular Economy“ heißt das Zauberwort, auf das die chemische Industrie in Sachen Umwelt und Klima setzt. Ging es zunächst vor allem darum, Teile der verbrauchten Produkte zu recyceln und neu zu verwerten, versteht die Branche heute unter Kreislaufwirtschaft viel mehr: „Es geht um den Kohlenstoff, der in unseren Produkten enthalten ist“, erklärt Jörg Rothermel, Experte für Energie, Klimaschutz und Rohstoffe beim Verband der Chemischen Industrie (VCI).
Denn aus Kohlenstoffketten baut man alle Chemikalien, aus denen wiederum Produkte wie Kunststoffe, Medikamente oder Waschmittel entstehen. „Diesen Kohlenwasserstoff wollen wir im Kreis führen“, sagt der Chemiker. Das Problem dabei: Nicht alles, was die Chemie herstellt, lässt sich zurückholen – zum Beispiel im Gelben Sack. Kohlenstoffhaltige Produkte wie Lacke, Farben, Klebstoffe oder Kosmetika zersetzen sich und landen als Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) in der Atmosphäre. Rothermel: „Wir wollen auch für diese Produkte neue Kreisläufe eröffnen und am Ende den gesamten Kohlenstoff zurücknehmen und in Kreisläufen führen.“ Dazu gibt es vier Möglichkeiten, die auch Chemieunternehmen in Rheinland-Pfalz entwickelnund einsetzen:
Klassisches Recycling
Kunststoffe (Polymere), die in Autos, Flaschen, Verpackungen oder Kühlschränken stecken, werden eingesammelt, sortiert und gehen sortenrein zurück zur Industrie. Dort bereitet man das Material auf und verarbeitet es zu neuen Produkten. Das klappt immer besser, der Rücklauf steigt. Das Problem: Unterschiedliche Kunststoffe wie PVC, PET oder Polyethylen kann der Laie kaum erkennen und korrekt entsorgen.
Chemisches Recycling
Gemischte Kunststoffabfälle, die den Löwenanteil ausmachen, lassen sich nicht so einfach trennen. Rothermel: „Dafür entwickeln wir auf breiter Front neue Methoden, um sie in ihre Ausgangsbestandteile zu zerlegen.“ Auf die Kunststoffreste wirken Wärme, Katalysatoren oder Lösungsmittel ein. Die Verfahren spalten die Polymerketten in kürzere Einheiten bis hin zu Monomeren auf. Die dabei gewonnenen Kohlenwasserstoffe führt man dem Stoffkreislauf erneut zu und ersetzt so primäre Ressourcen. Rothermel: „Das ist keine Science-Fiction mehr, wir sind bereits aus dem Labormaßstab heraus. Das wird eine große Zukunft haben.“ Kritiker bemängeln, dass bei dem Verfahren komplett neue Produkte aus den Materialien entstehen können – das sei deshalb kein echter Kreislauf.
Recycling aus Biomasse
Auch hierbei wird der Kohlenstoff, der im Produkt steckt, im Kreis geführt. So setzt etwa die Verbrennung Kohlenstoff frei, der als CO2 in die Umwelt gelangt. Das „Einsammeln“ des Treibhausgases übernehmen Pflanzen und produzieren dabei Sauerstoff (Photosynthese). Der Kreis schließt sich, sobald Unternehmen Biomasse wie Zucker, Öle oder andere nachwachsende Rohstoffe als Basischemikalie für neue Produkte einsetzen. Der Anteil an Biokunststoffen liegt heute bereits bei 13 bis 15 Prozent.
Recycling aus Kohlendioxid
Kohlendioxid lässt sich aber auch direkt aus der Luft nehmen und als Rohstoff nutzen. „Es ist chemisch-technisch möglich, aus Kohlendioxid und Wasserstoff Basischemikalien zu produzieren“, erklärt Rothermel. Versuche dazu habe es schon in der Vergangenheit gegeben (Fischer-Tropsch-Synthese). Noch sei das Verfahren unwirtschaftlich, sollte es aber im großen Maßstab funktionieren, wäre das „der größte Kreislauf, CO2 aus der Luft zu nehmen, solange es noch konzentriert aus den Fabrikschornsteinen kommt“. Rechnerisch könnte so ein Teil der Emissionen kompensiert werden, die etwa bei Zersetzung oder Verbrennung entstehen.
Mit einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft kann die chemische Industrie ihr ganz großes Ziel erreichen: bis 2050 treihausgasneutral produzieren. „Wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber ich bin optimistisch“, bekräftigt Rothermel. Es müssten jedoch alle mitziehen: „Wir benötigen gute Rahmenbedingungen von der Politik sowie wirtschaftliche Verfahren, die der globalen Konkurrenz standhalten. Auch die Gesellschaft muss mitarbeiten, die Produkte zurückführen und dazu bereit sein, solche Waren fair zu bezahlen. Sonst klappt es nicht.“