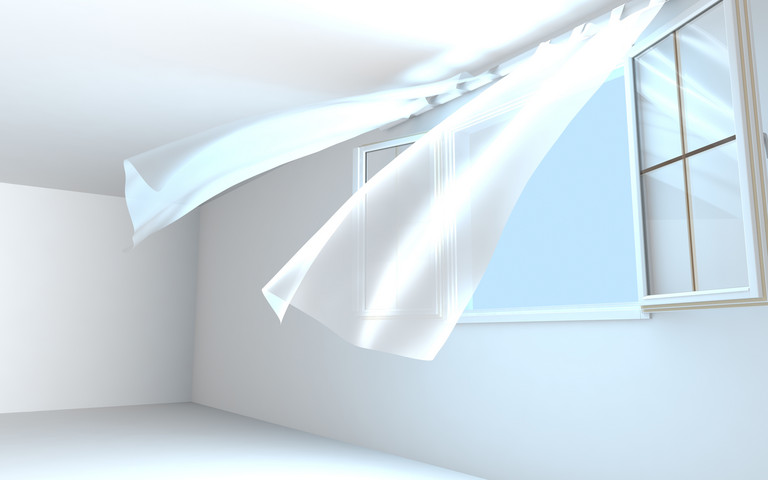Offene Fenster sind wichtig, um die Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus in Räumen zu senken. Wie genau wirkt das Lüften? Und wie lüftet man richtig? Wir haben 7 Fakten für eine bessere und gesündere Luft:
Was bringt das Lüften gegen Corona?
Lüften hilft, die Luft zu beseitigen, in der Aerosole mit Corona-Viren hängen können. Wichtig ist dabei der Blick auf die Luftwechselrate: Sie gibt an, welches Mehrfache des Raumvolumens an Luft pro Stunde erneuert wird. Bei geschlossenen Fenstern und Türen beträgt sie meist zwischen 0,1 und 0,3. Es werden also maximal 30 Prozent des Luftvolumens ausgetauscht. Ist eine mit dem Corona-Virus infizierte Person im Raum, verschwinden die von ihr verteilten Viruspartikel schlimmstenfalls erst nach Stunden. Stoßlüften bei weit geöffneten Fenstern kann die Luftwechselrate auf 9 bis 15 erhöhen, beim dauerhaften Querlüften mit Durchzug steigt sie sogar auf über 20. Dann können Luftströmungen die Viruspartikel hinaustragen.
Wie groß ist die Ansteckungsgefahr in geschlossenen Räumen?
Mit vielen Menschen in engen Räumen wird es zurzeit nicht nur schnell stickig, sondern gefährlich. Denn die Corona-Viruspartikel werden beim Ausatmen, Sprechen, Husten und Niesen als Bestandteil größerer Tröpfchen beziehungsweise Aerosole verteilt. Diese können stundenlang umherschweben und sind eine Ansteckungsgefahr. Das Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz hat einen Aerosol-Rechner erstellt, mit dem sich Ansteckungsgefahren für unterschiedliche Raumgrößen und Menschenmengen einschätzen lassen.
Wie lüfte ich richtig?
Wie lüftet man also so, dass das Ansteckungsrisiko sinkt? In Wohnungen (ohne zusätzliche Besucher) empfiehlt das Umweltbundesamt, im Winter zwei- bis dreimal pro Tag fünf bis zehn Minuten zu lüften. Das Gleiche gilt für kleine Büroräume. Generell sollte man die Fenster komplett öffnen, sie zu kippen hat nur einen eingeschränkten Effekt. Sind viele Gäste im Raum, etwa bei Familienbesuchen oder Besprechungen, sollte das Fenster die gesamte Zeit offen sein. In größeren Räumen mit vielen Personen – zum Beispiel Schulklassen – sollte alle 20 Minuten für bis zu fünf Minuten stoßgelüftet werden. Entsteht durch das Öffnen gegenüberliegender Fenster und Türen Durchzug, kann die Lüftungszeit kürzer sein.
Wie beeinflusst die Temperatur das Lüften?
Temperaturunterschiede zwischen der Luft draußen und jener in Innenräumen erhöhen die Austauschrate. Da die Temperaturdifferenz zwischen drinnen und draußen im Winter meistens größer ist als im Sommer, muss man in der wärmeren Jahreszeit die Lüftungsphasen verlängern. Um dieselbe Menge Luft auszutauschen wie in den kalten Wintermonaten, muss in den Übergangsmonaten April und Oktober das Fenster etwa dreimal so lange offen bleiben. Im Sommer von Juni bis August dauert es sogar fünfmal so lange.
Wie hilft Lüften gegen Schimmel?
Neben der Entfernung von Viruspartikeln aus der Raumluft hat das regelmäßige Lüften auch Corona-unabhängige Vorteile. So gibt ein Haushalt mit vier Personen im Schnitt durch Atmung, Schwitzen, Wäschetrocknen, Duschen und Kochen jeden Tag zwischen sechs und zwölf Liter Wasser an die Luft ab. Bei geschlossenen Fenstern und Türen setzt sich die Feuchtigkeit in den Wänden und Decken ab und kann zu Schimmel führen. Im Idealfall beträgt die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zwischen 40 und 60 Prozent. Liegt sie unter 30 Prozent, reizt die trockene Luft die Schleimhäute, ab 70 Prozent besteht Schimmelgefahr.
Warum kann ich mich in gelüfteten Räumen besser konzentrieren?
Beim Atmen wandeln Menschen Sauerstoff zu CO2 um. Im Schlaf atmet eine Person rund 10 bis 13 Liter CO2 pro Stunde aus, beim Arbeiten am Schreibtisch 19 bis 26 Liter und beim Handwerken bis zu 75 Liter pro Stunde. So entsteht die oft spürbar „dicke“ Luft in unbelüfteten Zimmern. Ein zu hoher CO2-Gehalt in der Luft macht müde und mindert die Konzentration. Regelmäßiges Auffrischen der Luft durch Stoßlüften hält uns also leistungsfähiger und wacher. Außerdem werden dadurch neben dem CO2 auch Feinstaub und Gerüche von Teppichen, Möbeln oder Wandfarbe aus der Raumluft entfernt.
Erspart ein Luftfilter das Lüften?
Mobile Luftreiniger mit sogenannten HEPA-Filtern können die Anzahl der Viruspartikel in Räumen reduzieren. Ein Ersatz für regelmäßiges Lüften und andere Vorkehrungen sind sie jedoch nicht, sagen sowohl das Robert-Koch-Institut als auch die Verbraucherzentralen. Filter können nur als Unterstützung dienen. Denn selbst wenn in jedem Raum eine Anlage stünde, verringerten die Filter nicht das Corona-Infektionsrisiko bei nahen Kontakten mit weniger als 1,5 Meter Abstand. Außerdem können sie immer nur den Luftbereich in ihrer Umgebung filtern, bei großen Räumen wären entsprechend große Anlagen nötig. In Schulklassen beispielsweise hält das Umweltbundesamt die Filter deshalb nur in Ausnahmefällen für sinnvoll. Und: Feuchtigkeit und CO2-Gehalt der Luft können die Filter nicht beeinflussen. Auch deshalb ist Lüften die bessere Alternative.