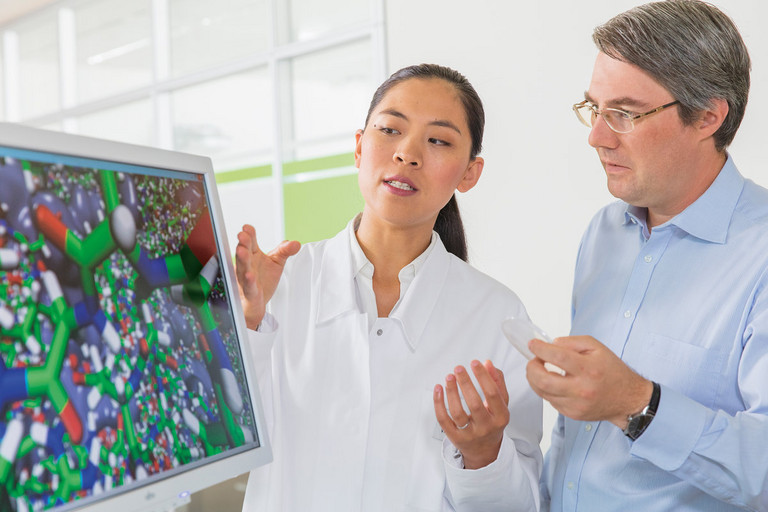Familienunternehmen beziehen Stellung: Mit dem Slogan „Made in Germany, made by Vielfalt“ zeigten kürzlich 50 Firmen klare Kante gegen Fremdenhass, neuen Nationalismus und Europafeindlichkeit. Mit dabei die Branchenkonzerne Boehringer Ingelheim, B. Braun (Hessen) und Henkel (Nordrhein-Westfalen).
Die Unternehmen treibt die Sorge vor wachsender Intoleranz um, sie wollen das Land nicht den Populisten überlassen. Aus gutem Grund, so argumentieren sie, heiße es „made in Germany“ und nicht „made by Germans“. Denn „täglich geben Mitarbeiter/innen aus aller Welt bei uns ihr Bestes“.
Und das sind nicht wenige. Beim Reifenhersteller Michelin in Bad Kreuznach hat ein Fünftel der 1.500-köpfigen Belegschaft eine andere als die deutsche Staatsbürgerschaft. Beim Pharmakonzern Boehringer Ingelheim schaffen 770 der 8.600 Mitarbeiter mit ausländischem Pass, beim Arzneihersteller AbbVie in Ludwigshafen ein Zehntel von 1.900 Beschäftigten. Und beim Konsumgüterhersteller Procter & Gamble ist es bundesweit jeder Neunte von 9.000 Mitarbeitern.
Ohne Kollegen aus dem Auslandwäre der Fachkräftemangel größer
Das sind keine Einzelbeispiele. Kollegen mit Migrationshintergrund gibt es in neun von zehn Großunternehmen, acht von zehn mittleren Firmen sowie jedem zweiten kleinen Betrieb. Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft in seinem Personalpanel ermittelt. Ohne ausländische Beschäftigte hätten einige Unternehmen ein Personalproblem. Der Fachkräftemangel wäre noch ausgeprägter.
Kolleginnen und Kollegen aus der Türkei, Italien, Frankreich, Portugal, Griechenland oder Polen verhindern das. Auch Beschäftigte aus Amerika, Afrika und Asien schaffen in deutschen Anlagen und Labors. Manche Belegschaften sind richtig bunt gemixt. Da kommen mal Menschen aus 29 Nationen zusammen (Michelin), mal aus 44 (AbbVie), aus 71 (Boehringer) oder 76 (Procter).
„Vielfalt als Leistungsmotor“
Mehr noch als um Manpower geht es den Unternehmen um Köpfe und Ideen. „Wir wollen Vielfalt als Leistungsmotor gestalten“, sagt Personalleiterin Heike Notzon von Michelin in Bad Kreuznach. „Vielfältige Teams, Talente und Persönlichkeiten bringen vielfältige Ideen und fördern die Innovation“, ist sie überzeugt. Auch bei Boehringer Ingelheim sieht man einen „guten Mix der Belegschaft als Erfolgsfaktor“. Dazu gehörten Menschen egal welchen Geschlechts, jeglicher kultureller Herkunft, Religion oder sexueller Orientierung. Der Chemiekonzern BASF setzt ebenfalls darauf. „Wir brauchen eine diverse Belegschaft, um die Ansprüche unserer Kunden aus aller Welt zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen für sie zu entwickeln“, sagt Gerhard Müller, Leiter der Einheit Diversity + Inclusion bei der BASF.
Multikulti beim Mittelständler: „Wir leben seit Jahren zusammen.“
Dass gemischte Teams erfolgreicher sind, belegen Studien. Wie zum Beispiel eine Untersuchung der Unternehmensberatung McKinsey aus dem Jahr 2018: Demnach steigt bei Unternehmen mit ethnischer Vielfalt im Management „die Wahrscheinlichkeit, überdurchschnittlich profitabel zu sein, um 33 Prozent“. McKinsey erhob dafür Daten bei 1.007 Unternehmen in zwölf Ländern.
Von Vielfalt profitieren auch kleine Firmen wie der Kunststoffplatten-Hersteller Polycasa in Mainz. „In gemischten Teams ist die Stimmung besser, und sie lösen Probleme leichter“, berichtet Personalleiter Christian Thomas. Die 125 Beschäftigten der Firma stammen zu einem Drittel aus der Türkei, Griechenland, Italien und Osteuropa. Multikulti sei bei ihnen normaler Alltag, sagt Thomas. „Wir leben seit Jahren zusammen.“