Die Digitalisierung ist ein Megatrend. Auch die rheinland-pfälzische Chemiebranche denkt in neuen Dimensionen, um im globalen Wettbewerb mitzuhalten. Als Prozessindustrie ist die Chemie zwar schon in hohem Maße automatisiert. Doch jetzt zeichnen sich neue Anwendungsfelder ab: Mithilfe digitalisierter Informationen lassen sich Kosten und Ressourcen sparen.
Da ist zum Beispiel die vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance), bei der sich mithilfe einer App einzelne Stellventile und Durchflussmessgeräte aus der Ferne überwachen lassen. Weitere Felder sind die digitale Landwirtschaft, eine bessere Steuerung der Logistik oder die modulare Produktion.
„Vom Einkauf über Produktion bis Vertrieb“
So prüft man derzeit etwa beim Lack- und Farbenhersteller Jansen in Ahrweiler, wo der Schritt ins neue Zeitalter ansetzen soll: „Man muss immer mit der Zeit gehen“, sagt Geschäftsführer Peter Jansen. Veränderungen gehören hier zur Tradition: „Wir schauen, wo Digitalisierung vom Einkauf über die Produktion bis hin zum Vertrieb Sinn macht und wo wir davon tatsächlich profitieren können.“
Damit hat er die Nase vorn. Denn laut der jüngsten Studie der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) sagen zwar 92 Prozent der heimischen Unternehmer, dass die Digitalisierung „große Auswirkungen“ auf ihre Geschäftsabläufe habe. Dennoch schätzen zwei Drittel ihren eigenen Grad der Digitalisierung als nur „mittelmäßig“ ein. Mehr Mut wünscht sich da Ministerpräsidentin Malu Dreyer: „Der neuen industriellen Revolution der Digitalisierung müssen wir genauso angstfrei und selbstbewusst gegenübertreten wie den vergangenen industriellen Revolutionen“, sagt sie. „Ohne Technikfeindlichkeit, mit klugen Ideen für Qualifizierung, für die Tarif- und die Sozialpolitik und für soziale Gerechtigkeit!“
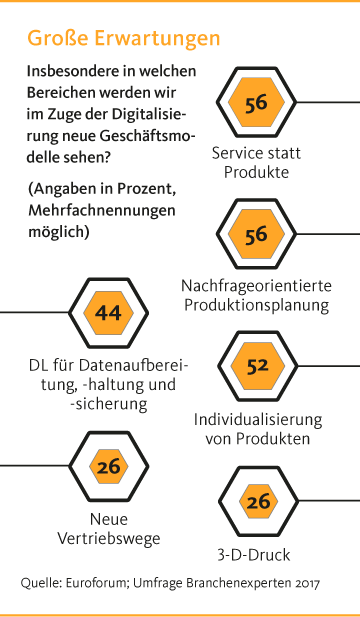
Viele Vorreiter in Rheinland-Pfalz
Einer, der die Entwicklung als Pionier vorantreibt, ist die BASF in Ludwigshafen. Gerade hat der weltgrößte Chemiekonzern seinen 1,75 Petaflops schnellen „Supercomputer“ in Betrieb genommen, der 1,75 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde schafft. Er soll helfen, den Datenschatz des Konzerns zu heben: „Wir sitzen auf einer wahren Goldmine und wissen nicht einmal, wie viel Gold drin ist“, sagt Vize-Vorstandschef Martin Brudermüller. Fest steht, dass der Megarechner etwa die Lebensdauer von Katalysatoren dreimal schneller berechnen kann. Und die Anzahl virtueller Experimente wird steigen: Nun lassen sich Tausende Versuchsreihen simulieren, durchrechnen und auswerten. In der Biotechnologie können Wissenschaftler auf der Suche nach vielversprechenden Enzymen oder geeigneten Bakterien für Produkte oder Prozesse mittels Data-Mining aus riesigen Datenbeständen Wissen schneller extrahieren. Und Landwirte nutzen zunehmend die BASF-Onlineplattform Maglis, um die Bewirtschaftung ihrer Flächen zu optimieren.
Mit Geld und strategischen Partnerschaften will auch das Spezialchemie-Unternehmen Evonik, das einen Standort in Worms hat, seine Position in der digitalen Welt weiter stärken: Bis zum Jahr 2020 sollen rund 100 Millionen Euro in die Entwicklung und Erprobung digitaler Technologien und den Kompetenzaufbau fließen. Im Fokus stehen dabei neue Geschäftsmodelle, Lösungen und Service für Kunden sowie die Qualifizierung von Mitarbeitern.
Unendlich groß ist die Welt zwischen den Nullen und Einsen, das weiß auch Harald Schaub, Chef der Chemischen Fabrik Budenheim. Er feuert besonders den Mittelstand an, diese Welt zu erobern: „Wir haben die Freiheit, unsere Unternehmen zu entwickeln und unsere Industriegesellschaft zu erneuern. Es liegt an uns!“ Dabei setzt er auf das starke Bündnis zwischen Firmen, Chemieverbänden, Betriebsräten und der Chemiegewerkschaft IG BCE.
Allerdings gibt es Stolpersteine auf dem Weg ins digitale Zeitalter. Laut ZIRP-Studie sind das: die Unsicherheit sensibler Daten sowie rechtliche Unsicherheiten bei Datenschutz und Online-Handel. Dazu kämen fehlende Fachkräfte und technische Standards, hoher Qualifizierungsbedarf und mangelnde Breitbandanschlüsse.
Auch interessant:
Wie Digitalisierung erfolgreich in die Praxis umgesetzt wird, lesen Sie in unserer Reportage.













